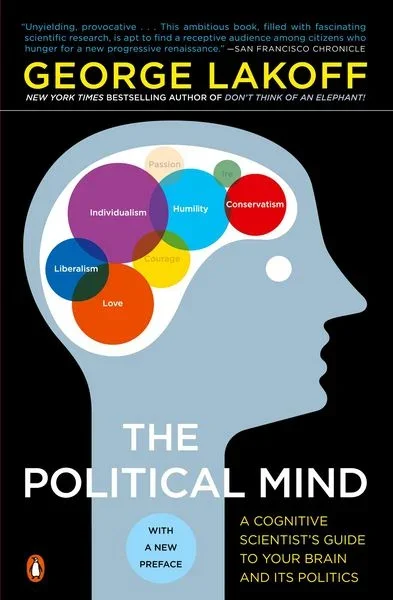Wie Sprache unser politisches Denken formt
Gedanken zu George Lakoffs Buch “The Political Mind”
Vor diesem Buch habe ich Framing kritisch betrachtet. Für mich war es gleichbedeutend mit Manipulation und bedeutete das Kommunizieren mittels verzerrender Narrative. George Lakoffs The Political Mind hat meine Sichtweise verändert. Heute sehe ich Framing differenzierter: nicht als Täuschung, sondern als unvermeidbare Art, wie wir Menschen die Welt wahrnehmen und verstehen.
Wer ist George Lakoff?
George Lakoff (*1941) ist Kognitionslinguist und einer der Begründer der Theorie, dass Sprache unser Denken formt. Als Professor in Berkeley prägte er die Forschung zur kognitiven Linguistik und zur Rolle von Metaphern. Er zeigte, dass wir nicht nur mit Sprache denken, sondern durch Sprache denken. Politische Überzeugungen sind demnach weniger das Ergebnis rationaler Abwägung als das Produkt sprachlich vermittelter Frames – gedanklicher Deutungsrahmen, die unser Verständnis lenken. Als Berater progressiver Bewegungen setzte Lakoff dieses Wissen ein, um politische Kommunikation wirksamer zu machen.
Worum geht es in The Political Mind?
In seinem 2008 erschienenen Werk argumentiert Lakoff, dass politische Überzeugungen tief in unserem Gehirn verankert sind. Sie entstehen nicht durch rationale Abwägungen, sondern durch moralische Frames, die unbewusst wirken und sowohl kognitive als auch emotionale Ebenen ansprechen.
„Reason requires emotion.“
Lakoff zeigt, dass rund 98 % unseres Denkens unbewusst ablaufen. Politische Weltbilder sind verkörpert, in neuronalen Strukturen verankert und von Emotionen geprägt. Sie lassen sich nicht einfach durch Logik verändern, denn Emotion ist nicht das Hindernis für Vernunft, sondern ihre Voraussetzung. Diese Erkenntnis widerlegt die Annahme der alten Aufklärung, dass Menschen durch rationale Argumente allein zu überzeugen seien.
Lakoff fordert deshalb eine neue Aufklärung, die anerkennt, dass wir die Welt durch Geschichten, Metaphern und gelebte Erfahrungen verstehen. Frames – kognitive Deutungsrahmen – strukturieren unser Denken, indem sie bestimmte neuronale Netzwerke aktivieren und verstärken. Narrative betten diese Frames in emotionale Geschichten ein, die moralische Werte verankern. Wer denselben Frame immer wieder nutzt, verändert langfristig die synaptischen Verbindungen im Gehirn – und damit die Art, wie Menschen denken.
Für die politische Kommunikation bedeutet das: Fakten allein überzeugen nicht. Daten und Logik entfalten erst dann Wirkung, wenn sie in eine Sprache eingebettet sind, die die richtigen Frames aktiviert, Emotionen anspricht und eine moralische Geschichte erzählt. Politik, die Sprache und Emotion ignoriert, verliert den Zugang zu den Menschen – und überlässt die Deutungshoheit jenen, die diese Mechanismen gezielt einsetzen.
Meine wichtigsten Erkenntnisse aus dem Buch
1. Frames sind keine Manipulation, sondern ein linguistisches Grundprinzip
„Frames are networks in the brain.“
Lakoff macht deutlich, dass Frames nicht einfach rhetorische Werkzeuge sind, sondern tief in unserer Kognition verankert. Sie sind mentale Deutungsrahmen, die bestimmen, wie wir Informationen interpretieren. Jeder Begriff, jedes Bild und jede Metapher aktiviert automatisch einen bestimmten Frame. Dieser Frame wiederum ruft Emotionen und moralische Bewertungen hervor, die unser Denken lenken, bevor wir uns dessen bewusst sind.
Das Beispiel Steuererleichterung (tax relief) zeigt, wie mächtig Frames wirken. Der Begriff impliziert, dass Steuern eine Last sind, von der man befreit werden muss. Wer diesen Begriff verwendet, übernimmt unbewusst die Sichtweise, die in ihm steckt. Selbst eine noch so sachliche Widerlegung kann den Frame nicht neutralisieren, sondern aktiviert ihn erneut.
Lakoffs berühmtestes Experiment verdeutlicht das: „Denke nicht an einen Elefanten!“ Sofort erscheint das Bild des Elefanten im Kopf. Es ist unmöglich, den Frame zu vermeiden, sobald er genannt wird. Für die Kommunikation heisst das: Es genügt nicht, gegnerische Frames zu kritisieren, man muss eigene Frames entwickeln. Diese müssen klar, emotional anschlussfähig und moralisch verankert sein, damit sie im Gehirn der Menschen die richtigen Netzwerke aktivieren.
Für mich als Kommunikatorin ist dies eine der wichtigsten Erkenntnisse aus dem Buch: Framing ist kein manipulativer Trick, sondern ein unvermeidbarer Teil unserer Sprache und unseres Denkens. Wer es bewusst gestaltet, übernimmt Verantwortung für die Bilder, Emotionen und Werte, die er oder sie in den Köpfen anderer aktiviert.
2. Politische Moral drückt sich über sprachliche Metaphern aus
„Metaphors are mental structures that are independent of language but can be expressed through language.“
Lakoff zeigt, dass moralische Weltbilder durch Metaphern organisiert sind. Identität ist die Basis von Politik. Er stellt zwei grundlegende moralische Modelle gegenüber, die unser politisches Denken strukturieren:
Das „Strict Father“-Modell (konservativ) betont Autorität, Disziplin und Eigenverantwortung. Der Staat wird wie ein strenger Vater verstanden, dessen Rolle darin besteht, Regeln durchzusetzen, Ordnung zu wahren und moralische Stärke zu fördern.
Das „Nurturant Parent“-Modell (progressiv) basiert auf Empathie, Fürsorge und gegenseitiger Unterstützung. Hier ist die Rolle der Regierung Schutz und Ermächtigung ihrer Bürger:innen, woraus Werte wie Gleichheit, Freiheit, Fairness, Chancen für alle, allgemeiner Wohlstand und Verantwortung abgeleitet werden.
Aus diesen metaphorischen Grundmodellen entstehen Narrative über Freiheit, Fairness oder Autorität – Narrative, die politisches Handeln leiten.
3. Warum wir Politik nicht in isolierten Themen verstehen können
„The left-to-right scale is an inadequate metaphor. It hides the fact that most people are biconceptual, using both progressive and conservative thought in different parts of their lives.“
Lakoff kritisiert, dass politische Überzeugungen oft durch zu simple Bilder beschrieben werden. Besonders problematisch ist die Links-rechts-Skala. Diese Metapher suggeriert, dass sich alle politischen Haltungen auf einer geraden Linie anordnen lassen. Für Lakoff ist das nicht nur unzutreffend, sondern auch gefährlich, weil sie komplexe moralische Strukturen auf eine eindimensionale Logik reduziert. Sie verschleiert, dass Menschen häufig bikonzeptuell denken. Sie können progressive und konservative Denkweisen in unterschiedlichen Lebensbereichen gleichzeitig haben. Als Beispiel nennt er hier die Haltungen bzgl. Abtreibung und der Todesstrafe.
Eng damit verbunden ist seine Kritik an den „Issue Silos“. Politische Debatten werden oft in voneinander isolierte Themenfelder aufgeteilt, Z. B. Umwelt, Wirtschaft, Bildung, etc. ohne den moralischen Rahmen zu berücksichtigen, der diese Themen verbindet. Erfolgreiche Kommunikation muss daher über einzelne Themen hinaus den übergeordneten moralischen Rahmen sichtbar machen.
4. Sprache formt Realität
„Framing precedes policy.“
Lakoff zeigt, dass Sprache nicht nur ein neutrales Mittel zur Beschreibung ist. Sie bestimmt, wie wir die Welt wahrnehmen und welche Handlungen wir für möglich oder notwendig halten. Frames wirken wie Filter, die Informationen selektieren und ihnen Bedeutung geben.
Ein bekanntes Beispiel ist der Begriff war on terror. Dieses Framing definiert den Kampf gegen den Terrorismus nicht als polizeiliche Aufgabe, sondern als Krieg. Dadurch werden automatisch Rollen aktiviert – Feinde, Helden, Opfer – und politische Entscheidungen wie militärische Einsätze erscheinen legitim. Die Sprache hat hier nicht nur die Realität beschrieben, sie hat sie mitgestaltet.
Frames transportieren immer Werte. Sie beantworten unterschwellig die Fragen: Wer ist gut? Wer ist böse? Wer verdient Unterstützung? Genau darum sind sie für politische Kommunikation so entscheidend.
Sprache formt also nicht nur Meinungen, sie formt die Welt, in der wir handeln. Wer sie bewusst einsetzt, gestaltet Politik auf einer tieferen Ebene, noch bevor Entscheidungen getroffen werden.
5. Narrative verändern Denken – Wort für Wort, Synapse für Synapse
„You can’t learn anything without your synapses changing.“
Lakoff beschreibt, dass wiederholte Sprache neuronale Verbindungen stärkt. Jedes Mal, wenn ein Frame aktiviert wird, werden die entsprechenden Netzwerke im Gehirn gefestigt. Das erklärt, warum konservative Sprachmuster über Jahrzehnte hinweg das Denken vieler Menschen geprägt haben: Sie wurden konsequent, emotional aufgeladen und in immer neuen Kontexten wiederholt.
Für die Kommunikation bedeutet das: Es reicht nicht, gegnerische Frames zu widerlegen, wenn man dabei deren Sprache übernimmt. Schon das blosse Wiederholen aktiviert das bestehende Netzwerk und macht es stärker. Das gilt auch dann, wenn man am Ende ein «aber» anhängt oder den Frame eigentlich kritisieren will. Darum gilt: Eigene Frames entwickeln und diese konsequent verwenden. Sie müssen sprachlich klar, emotional anschlussfähig und moralisch verankert sein. Wer die Deutungshoheit behalten will, muss diese Narrative konsequent aufbauen und wiederholen .
Dieser Mechanismus ist aus der Krisenkommunikation bekannt: Negative oder gegnerische Begriffe sollten nicht übernommen werden, weil sie im Kopf des Publikums die falschen Bilder auslösen. Stattdessen braucht es eigene Narrative, die die gewünschten Bilder, Emotionen und moralischen Werte aktivieren.
Was ich aus der Lektüre mitnehme
Das Buch hat mir gezeigt, dass politische Kommunikation immer sprachlich und emotional ist. Öffentliche Debatten sind nicht „emotionalisiert“, sie sind emotional – weil Sprache Emotionen trägt. Sprache ist kein neutrales Werkzeug. Sie ist der Schlüssel, mit dem wir Denkweisen aktivieren oder verändern. Wir können politische Frames nicht vermeiden, wir können sie nur bewusster gestalten. The Political Mind ist ein Buch, das die enge Verbindung zwischen Sprache, Emotion und Politik schonungslos offenlegt. Es zeigt, warum Fakten allein kaum Wirkung entfalten und warum Worte Träger von Weltbildern sind. Framing ist dabei nicht die Ausnahme, es ist die Regel – und wir haben die Wahl, ob wir diese Regel anderen überlassen oder selbst gestalten. Als Kommunikator:innen müssen wir verstehen, dass Worte nicht nur Fakten transportieren, sondern Emotionen aktivieren und Bedeutungen rahmen.
Was sind Frames und Narrative?
Frame
Definition: Ein Frame ist ein mentaler Deutungsrahmen, der unser Verständnis strukturiert.
Funktion: Frames ordnen Fakten, lenken Aufmerksamkeit und geben Ereignissen eine bestimmte Bedeutung.
Beispiel: Der Begriff Steuererleichterung ruft den Frame auf, dass Steuern eine Last sind, von der man befreit werden muss.
Eigenschaft: Frames sind oft sehr kompakt (ein Wort oder eine Metapher kann sie aktivieren), sie wirken unbewusst und automatisch.
Narrativ
Definition: Ein Narrativ ist eine erzählende Struktur, die Ereignisse, Akteure und Werte in einen sinnstiftenden Zusammenhang bringt.
Funktion: Narrative transportieren Frames, indem sie Geschichten erzählen, die Rollen (Held, Opfer, Bösewicht) und moralische Botschaften enthalten.
Beispiel: Der Staat schützt die Schwachen vor den Mächtigen ist ein Narrativ, das den progressiven Frame von Fürsorge und Gleichheit stützt.
Eigenschaft: Narrative sind komplexer, sie entfalten Frames in Geschichten und Kontexten, die über längere Kommunikation hinweg wirken.
Wie hängen sie zusammen?
Frames sind die Bausteine, aus denen Narrative bestehen.
Narrative sind die Geschichten, in denen Frames lebendig werden und emotional wirken.
Lakoff betont:
Wer Frames setzt, schafft die Grundlage dafür, wie Themen verstanden werden.
Wer Narrative erzählt, verankert diese Frames emotional und langfristig im Denken der Menschen.